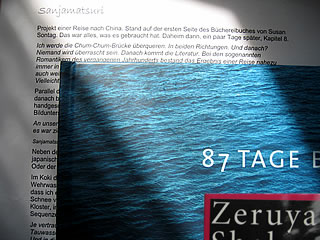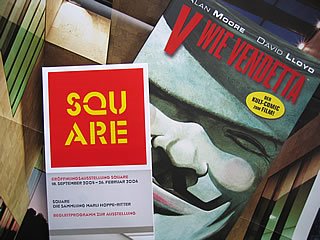Sonntag im Flieger. Wolken über Deutschland, die sich weiter nach Frankreich ziehen. Auch weiter nach Spanien, Barcelona, die Küste, das Meer, sie alle sind mit dem Wolkenteppich bedeckt. Erst beim Landeanflug bekommt man etwas Mallorca zu sehen. „Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt,“ sagt die Stewardess über den Bordlautsprecher. Und: „Bitte verlassen sie das Flugzeug durch den vorderen Ausgang.“
Also Jacke wieder an, Rucksack auf, einreihen. Sich wünschen, man hätte den Regenschirm als symbolische Geste der Akzeptanz gegenüber der Allmacht von Petrus doch eingepackt, anstatt ihn demonstrativ zu Hause liegen zu lassen.
Immerhin hatten wir ja die letzten Jahre schönes Wetter, denke ich, versuche mich angesichts der stockenden Menschenschlange schon einmal in Gleichmut zu üben, gehe einen halben Schritt weiter und sehe – ein Taschenbuch. Das dort vergessen zwischen Duty-Free-Magazin und Focus Money steckt. Ich angle es aus dem Netz. Und muss lächeln. Es ist: „Der Schwarm“. Der Ozeanthriller von Frank Schätzing, den ich vom Buchabend kenne. Ein Buch, das ich mir selbst wohl nicht gekauft hätte. Und dass ich nun hier finde, und aufschlage, auf einer zufälligen Seite. Um über das Warten zu lesen.
Nach einer Weile änderten die beiden Inuit in dem zuvorderst fahrenden Qamutik die Fahrtrichtung. Einen Moment war Anawak verwirrt, dann sah er, dass sie eine klaffende Eisspalte umfuhren. Jenseits der bläulichen Kante war schwarzes, unergründliches Meerwasser zu erkennen.
"Das kann ein bisschen dauern", meinte Akesuk.
"Ja, es kostet Zeit", nickte Anawak.
Akesuk krauste die Nase.
"Nein. Warum sollte es welche kosten? Wir opfern keine Zeit. Wir behalten sie, ob wir nun direkt nach Osten fahren oder erst ein Stück weiter nördlich. Hast du alles vergessen? Hier ist nicht wichtig, wie schnell du ankommst. Wenn du einen Umweg fährst, findet dein Leben trotzdem statt. Keine Zeit ist verloren."
Und die Zeit für den Schwarm ist also hier auf Mallorca, denke ich und nehme das Buch mit. Ohnehin, welch besseren Ort gäbe es ein Buch über die Meere und das andere mögliche Leben darin zu lesen als am Meer selbst?
Dann der Bus, warten bis alle angekommen sind, bis die Dame vom Reisebüro da ist und verkündet, dass es jetzt los geht, und man sich ab nun nur zurückzulehnen bräuchte, da ab jetzt sie sich um alles kümmern würde, und daraufhin dann winkend aussteigt und uns unserem bewölkten Schicksal überlässt. Die bewölkten Wendungen setzten sich dann auch beim Eintreffen in Pollenca fort: leider ist die Anlage fast voll belegt, und so gibt es für uns nicht das gewünschte Appartment mit Terrasse am Teich, sondern die Variante eine Ecke weiter, am Weg zum Pool. Wir packen unsere Sachen aus, und schauen dann ob der kleine Laden offen hat. Hat er Sonntags nie. Also gut. Dafür laufen wir in einem Akt der Selbstfrustration eine Extrarunde durch die Anlage, um die anderen Appartments anzuschauen. Vor einem Doppelappartment mit integriertem Palmengarten und passendem Palmenloch im Dach bleibt Ronnie stehen. „Das ist ja auch knuffig,“ meint er. Dann laufen wir zurück zu unserem unknuffigen Heim.
„Na gut,“ sage ich zu Ronnie, „dafür wird es ja nun sonniger. Und lieber besseres Wetter als besseres Appartment. Und eigentlich ist es ja auch ganz okay.“ Was stimmt, bis auf die Atmosphäre. Verraucht. Oder eher: Bedrückt. Als ob die Vormieter hier ihre schlechte Laune zurückgelassen hatten. Ich mache die Türen auf, denke ernsthaft daran, Räucherstäbchen zu kaufen. Irgendetwas ist mit dem Raum, ist in dem Raum. Ein Gedanke, der noch verstärkt wird durch das Buch, das ich lese: Schattengäste von Joan Aiken. Auch eines dass ich nicht selbst ausgesucht habe: meine Cousine hat es aussortiert, meiner Mutter gegeben, und sie hat es dann an mich weitergereicht. Und so finden mich die Fragen von Cosmo, dem Jungen im Buch, nun hier:
"Aber – wenn es andere Dimensionen gibt – kann dann eine Verbindung bestehen zwischen dem, was dort geschieht – und uns? ..Oder gibt es vielleicht zwei Arten von Menschen, die Messenden und die Kämpfenden?“Am Montag, nach einer Nacht voller Schlaf, und dem Traum mit dem Garten, mit dem Gärtner der mir dir guten und die schlechten Wurzeln zeigt, dann Frühstück im Freien. Und dann wieder, das Gefühl dass wir am falschen Platz sind. Also gut, denke ich, und mache mich auf den Weg zur Rezeption, um nach einem anderen Zimmer zu fragen. Die Frau dort knobelt 5 Minuten in Listen. „Morgen wird etwas frei,“ sagt sie, „Baco Uno wäre das.“ Von Villa Rio zu Villa Baco, denke ich, und mache mich mit skeptischer Hoffnung auf den Weg zu Baco. Und lande – direkt vor dem Appartment mit dem Palmenloch im Dach. Das ist unseres, denke ich, und kläre an der Rezeption das wie und was des Umzugs. Würde am liebsten gleich die Sachen packen, auch wenn der Umzug mit unserem Gepäck ein kleinerer Akt ist. Warum hat das Appartment auch nicht gleich frei sein können, denke ich. Und versuche es dann als Erfahrung zu sehen. So fühlt man sich an einem Ort an dem man sich nicht wohl fühlt. Kommt ja immer mal wieder vor, und besser im Urlaub als daheim. Dann klappe ich mein kleines Reisetagebuch auf, blättere auf die erste Seite und lande – im Januar 2005. Bei der Reise nach Florida, die an einem Sonntag hätte anfangen sollen, die aber durch einen Schneesturm in Atlanta mit einem Tag Verspätung anfing. Und zu der Efrat eine israelische Weisheit schickte, als sie von der Verzögerung hörte: „Every delay is for the best.“
Keine Zeit ist verloren, fällt mir dabei wieder ein. Und es war ja nicht einmal etwas negatives passiert. Es war nur meine eigene Erwartung an das Hier und Jetzt, die enttäuscht worden war. Als wir das erste Mal hier waren, wussten wir noch nicht einmal etwas von den Appartments. Und hatten ein normales Zimmer. Und waren glücklich darin. Doch dann sahen wir irgendwann die Appartments, und dachten, „das wäre ja schön“. Und hatten dann beim nächsten Urlaub eines mit Blick zum Pool. Und beim Urlaub darauf eines an einem Teich. Mit Fröschen, und mit fließendem Wasser. Und das wurde dann zum Standard. Wie auch das Urlaub machen selbst.
„Das alles gabe es vor ein paar Jahrzehnten noch nicht einmal,“ sagte ich beim Strandspaziergang. Und stolperte dann ein paar Schritte weiter über ein kleines quadratisches Objekt, das sich als Kerze entpuppte. Mit Docht, der noch weiß war. Wo kam die nun her? Vom Meer, angespült von dem Gedanken an Räucherstäbchen?
„Die ist für Baco Uno,“ sagte ich, und steckte sie ein. Nur noch ein Tag, dann würden wir dort sein. Und bis dahin sollte ich vielleicht einfach im Jetzt bleiben, das sich „Ceres Quatro“ nannte.
~~
Ein paar Tage später beginnt dann in Baco Uno der Tag mit der Zeit, der Loreley und mit ihr verknüpfte Gedanken zur Dichtung und zur List der Übertragung:
"Das Märchen ergreift ihn, weil es ein Stück intimes Wissen, das im Dunkel einer Vergessenheit gelegen hat, zurück ins Bewusstsein rückt. Am Gipfel des Berges, auf dr Horizontlinie zwischen Land und Himmel, funkelt die Abendsonne. Als letzter Sonnenstrahl erhält dieses Aufleuchten seine besondere Wirksamkeit dadurch, dass wir sein Erlöschen ahnen und somit auch die Flüchtigkeit aller irdischen Beleuchtung. ..Der Schiffer mag am Felsriff zerschellen, weil er gänzlich im wilden Weh des Stimmungstaumels aufgeht. Der Dichter hingegen umschifft erfolgreich die Gefahr, die das alte Märchen ihm in den Weg legt. Er erliegt seiner Melancholie nicht, weil er aus eigener Kraft als dessen Quelle eine mythische Sängerin heraufbeschwören kann."Die Poesie, die aus eigener Kraft geschöpft wird, die einen um die Klippen des Lebens zu tragen vermag. Als Parallelstück dazu, ein paar Seiten und Zeiten früher, ein Gedicht von Menantes, an das ich dann beim Spaziergang am Strand wieder dachte:
"Dieses Weltmeer zu ergründen
Ist Gefahr und Eitelkeit
In sich selber muß man finden
Perlen der Zufriedenheit"~~
Daheim dann ein Buch, das ich eigentlich schon alleine wegen des Titels mit ans Meer hätte nehmen sollen. "Im Schatten der Wellen" heißt es, von Brigitte Giraud geschrieben. Als ich es in der Bücherei aufgechlagen habe, wusste ich mit einem Satz dass ich es mitnehmen würde: eine der Figuren im Buch heißt wie ich, nur mit Accent, und mit dem Dreher, dass sie im Buch die jüngere Schwester ist, während ich in Wirklichkeit die ältere bin: Dorothée.
Und so ist die Stelle, die ich vom Buch behalten möchte, auch eine Stelle über das Schwimmen lernen, mit ihr, mit mir:
"Sie waren willens, ihr Bestes zu geben. Doch Vincent war nicht sehr geduldig, und Dorothée nicht sehr mutig. Die beiden Kinder bemühten sich eine Zeitlang, doch nach einigen Versuchen gaben sie auf. Dorothée wollte erst am nächsten Tag weitermachen. Vincent war sichtlich enttäuscht und warf ihr vor, keine gute Schülerin zu sein. Vincent mochte es nicht, wenn man sich ihm widersetzte. Dorothée mochte es nicht, wenn man sie zu etwas zwang. Diese beiden hatten sich gesucht und gefunden, stellten sich gegenseitig auf die Probe."~~~~